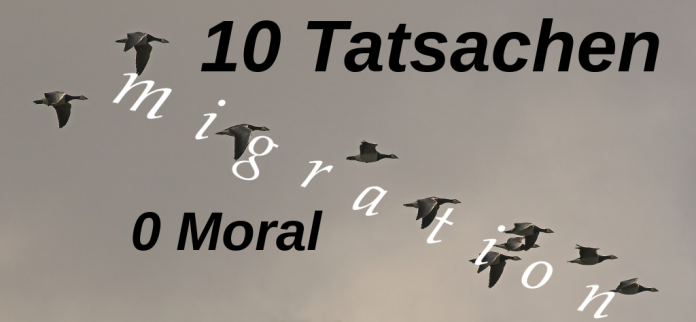Kaum ein Thema spaltet und emotionalisiert die österreichische Wählerschaft so stark wie die Migrationsfrage. In kaum einem Thema bringen die entgegengesetzten Lager so wenig Wertschätzung füreinander auf. Ein Sebastian Kurz versucht, eigene Politikmaßnahmen in der Migrationspolitik als Heldentaten darzustellen, die ihn für höhere Weihen vorbestimmen. Manche seiner Gegner sehen in ihm wegen genau derselben Maßnahmen einen gewissenlosen Hochstapler. All dieser emotionalisierte Aufruhr ist ärgerlich und unnötig. Denn obwohl der Umgang mit dem Einwanderungsdruck aus dem Südosten und Süden die EU vor eine beträchtliche Herausforderung stellt, ist die Thematik an sich gar nicht besonders kompliziert oder schwer zu verstehen.
Ein großer Schritt wäre bereits getan, wenn sich alle Teilnehmer an der Debatte auf zehn einfache Grundtatsachen verständigen könnten, für die MoralFragen keine Rolle spielen:
- Österreich ist ein kleines Land. Aber auch die EU ist gemessen an der heutigen und zukünftigen Bevölkerungszahl in Afrika und in den absehbar noch von Massenarmut bedrohten Teilen Asiens (Pakistan, Bangladesch, Afghanistan, eventuell Indien) viel zu klein, um Migrationsbewegungen beliebigen Umfangs aufzunehmen. Allein die Bevölkerung Afrikas wird sich von 1,2 Milliarden Menschen im Jahr 2015 bis 2050 auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln.
- Große Migrationsbewegungen über die europäischen Aufnahmekapazitäten hinaus könnten in den nächsten Jahrzehnten durch wirtschaftliche, politische und in Zukunft vielleicht auch ökologische Faktoren jederzeit entstehen, auch wenn sich die weltweite Verringerung der absoluten Armut in den nächsten Jahrzehnten fortsetzt. Zusätzlich ist Arbeitsemigration in manchen unterentwickelten Regionen wegen der möglichen Geldrücksendungen heute das am besten funktionierende Entwicklungsmodell.
- Eine restriktive Migrationspolitik ist daher einfach aus rechnerischen Gründen unvermeidlich. In bestimmten Situationen müssen viele Menschen physisch davon abgehalten werden, sich in Europa niederzulassen. Die einzige Alternative kommt nur theoretisch in Frage: Den Sozialstaat abzuschaffen und so lang unbeschränkte Zuwanderung zuzulassen, bis durch weitgehende Angleichung der österreichischen Lebensqualität am unteren Ende der Wohlstandsverteilung an jene der Herkunftsländer die Migration zum Stillstand kommt. Für solche extreme gesellschaftliche Ungleichverteilung gibt es in Österreich keine nennenswerte Unterstützung.
- Alle Menschen sind gleichberechtigt. Ein Österreicher ist nicht mehr wert als der Bürger eines beliebigen anderen Landes. Aber die nationalstaatliche Politik in Österreich ist in erster Linie den dauerhaft hier lebenden Menschen verpflichtet. Das ist eine verwaltungstechnische Feststellung, keine rassistische. Die EU-Kommission ist in erster Linie den Menschen in Europa verpflichtet. Die Vereinten Nationen sind für die gesamte Menschheit zuständig. Jeder Einwohner Österreichs ist auch ein Einwohner der EU und des Planeten und damit auch diesen anderen Gruppen, administrativen Einrichtungen und dem universellen Humanismus verpflichtet. Aber wenn wir über nationale Migrationspolitik sprechen, dann sind die dauerhaften Einwohner Österreichs der einzig sinnvolle Bezugsrahmen.
- Eine berechtigte demokratische Debatte betrifft die Frage, welche administrative Einheit – Gemeinde, Region, Nationalstaat, EU, Menschheit – eine wie prominente Rolle in der Migrationspolitik spielen soll. Über dieses Thema muss und soll gestritten werden, das ist produktiv. Die Gewichte werden sich im Zeitverlauf immer wieder verschieben.
- Wenn aber einmal für eine bestimmte Phase die Einflüsse der verschiedenen Ebenen als vorübergehender Kompromiss abgesteckt sind, dann folgt alles Weitere fast automatisch. Ein Nationalstaat wie Österreich ist durchaus imstande, auf Basis der demographischen Entwicklung und der Entwicklung des Arbeitsmarkts seine Aufnahmekapazität zu bestimmen. Er wird dann auf seine Unterhändler im kontinentalen Rahmen einzuwirken haben, damit diese entsprechende Vereinbarungen abschließen.
- Diese Vereinbarungen werden vielfältig und unterschiedlich ausfallen und mit einer recht großen Anzahl einzelner Herkunftsländer abzuschließen sein, besonders in Afrika südlich der Sahara. Darauf weist Gerald Knaus in einem Standard-Interview zurecht hin. Die Fixierung der Debatte auf die Mittelmeer-Anrainerstaaten ist eine falsche Analogie zum Übereinkommen mit der Türkei. Die Rückführung abgelehnter Einwanderer auf der Mittelmeerroute wird nicht per Schiff erfolgen, sondern per Flugzeug. Nicht nach Libyen, sondern nach Nigeria, Gambia oder Äthiopien. Das wird teuer sein, aber diese Kosten sind unvermeidlich.
- Die Problematik der Zwischenlager auf europäischem Boden sollte dadurch reduziert werden, dass die Aufenthaltsdauer der meisten Migranten, die nicht bleiben können, durch sehr schnelle Verfahren kurz gehalten wird. Je kürzer die Verfahren, umso kleiner die Lager und umso leichter wird den Abgewiesenen auch die Rückkehr fallen.
- In manchen Ländern wird die Herstellung bilateraler Vereinbarungen trotzdem scheitern, aus heutiger Sicht vorstellbar z.B. in Eritrea, wo Menschen vor einem Militärdienst auf Lebenszeit flüchten und bei einer Rückführung als Deserteure drakonisch bestraft würden. Auf absehbare Zeit wird es Regime geben, mit denen eine Einigung nicht herstellbar sein wird. Wenn es sich dabei um kleinere Länder wie Eritrea handelt, ist das lösbar. Aber in anderen Fällen können schwer bewältigbare Szenarien eintreten. Falscher Optimismus ist hier fehl am Platz.
- Entwicklungsunterstützung für die Herkunftsländer wird zur mittelfristigen Vermeidung derartiger Krisenfälle notwendig sein, aber die Erwartungen daran sollten in bescheidenem Rahmen bleiben. Diese und andere Maßnahmen führen allmählich in Richtung einer Welt-Innenpolitik, in der die schlimmsten Diktaturen nicht mehr akzeptiert werden – sicher eine langfristige Perspektive bis in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts, aber eine entscheidend wichtige. Dabei spielen kontinentale Entwicklungen eine große Rolle, in Afrika etwa die Stärkung von panafrikanischen Organisationen wie der Afrikanischen Union.
In diesen zehn Punkten spielen moralische Kategorien gar keine Rolle. Die gegenseitigen moralischen Vorwürfe entstehen oft erst aus der Hitze der Auseinandersetzung oder aus Temperament-Unterschieden, sind aber schädlich für den Konsens in der Gesellschaft. Ebenso besteht hier keine Verbindung zur Terrorismus-Diskussion. Terrorismus ist Kriminalität und genau so zu bekämpfen, alles andere wäre ein unnötiges Zugeständnis an die perfiden Absichten der Täter. Migration ist im Vergleich dazu eine viel wichtigere Fragestellung an die Gesellschaft. Aber keine, die nur von Genies gelöst werden kann, ein bisschen Nüchternheit reicht völlig aus.